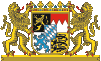Landschaft und Ressourcen
Was Gemüseanbau mit Solidarität zu tun hat
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
SoLaWi Isartal
(10.02.2025) Weyarn, Lkr. Miesbach - Solidarische Landwirtschaft entwickelt sich zunehmend als zukunftsweisendes Modell, das Produzenten und Konsumenten in den Mittelpunkt rückt. Die direkten Beziehungen zwischen diesen beiden Gruppen ermöglichen eine nachhaltige Lebensmittelproduktion und eine Stärkung der regionalen Gemeinschaft. Beispiele in Weyarn und Baierbrunn zeigen, wie das funktioniert.
Jana Heenen hat sich einen hübschen Ort für ihren Gemüsebaubetrieb ausgesucht: Auf einer Hanglage mit Alpenblick bei Weyarn im Landkreis Miesbach baut sie eine bunte Vielfalt an Gemüse an, wie Brokkoli, Zwiebeln, Karotten, Spinat, Rote Bete, verschiedene Kohlsorten und Salate. Die Ernte füllt Gemüsekisten für Privatkunden und Restaurants. Geliefert wird von Mai bis November an Verbraucherinnen und Verbraucher hauptsächlich im Raum Weyarn und Miesbach. „Die Produkte haben Bio-Qualität und sind das Ergebnis eines durchdachten Anbausystems, das die Natur und die Bedürfnisse von Konsumenten berücksichtigt“, sagt Jana Heenen. „Wir praktizieren Market Gardening, d.h. intensives, effizientes Gärtnern auf kleinstrukturierter Fläche mit optimaler Ausnutzung und Direktvermarktung. Die studierte Betriebswirtin und gelernte Gärtnerin hat im Jahr 2022 ihr eigenes Unternehmen mit dem Anliegen gegründet, nachhaltige und gesündere Produkte aus regionalem Anbau anzubieten. Unterstützung erhielt sie unter anderem durch eine zweifache Förderung der ländlichen Entwicklung im Rahmen der Ökomodellregion.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Jana Heenen
Diese Art der Vorfinanzierung schafft nicht nur ein Gemeinschaftsgefühl und Wertschätzung für die Produkte, sie fördert auch die Artenvielfalt, den Naturschutz und bewahrt die Kulturlandschaft durch eine schonende Anbauweise und somit zukunftsfähige Landwirtschaft, beschreibt Jana Heenen die Vorteile der Solawi. Das Wesen dieses Prinzips besteht darin, dass die Verbrauchergruppe durch Vorfinanzierung die Produktion und Abnahme der Erzeugnisse garantiert. Das unternehmerische Risiko und die Kosten verteilen sich somit auf mehreren Schultern. Gleichermaßen wird durch dieses Zusammenspiel die Landwirtschaft an sich und nicht nur ein einzelnes Lebensmittel finanziert. Zudem werden die Erzeugnisse nicht mehr über den Markt vertrieben, sondern über einen eigens von den Teilhabenden organisierten und finanzierten, transparenten Wirtschaftskreislauf. Somit genießen Produzierende und Verbrauchende die Vorteile einer weniger marktabhängigen Landwirtschaft. Letzteres war auch für Jana Heenen ausschlaggebend.
Ein besonderes Angebot in Weyarn wie auch vieler anderer Solawi-Betriebe sind Mitmachtage, die einmal im Monat stattfinden und bei denen Ernteteilhabende aktiv im Anbauprozess mitarbeiten können. „Es ist nicht nur eine Nahrungsmittelproduktion, sondern auch ein Bildungsauftrag“, merkt Jana Heenen an. Die Verbraucher sind direkt in den Produktionsprozess eingebunden und erhalten einen tieferen Einblick in die Herausforderungen und Freuden der Landwirtschaft. Dies fördere nicht nur das Bewusstsein für die Lebensmittelproduktion, sondern stärke auch das Gemeinschaftsgefühl.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Jana Heenen
Eine große Unbekannte war zudem, ob sich die Abnehmer auf die neuen Bedingungen einlassen würden. Denn statt einer Berechnung pro Kultur ist nun eine fixe Summe für einen Anteil zu zahlen und Jahresverträge nur mit Sonderkündigungsrecht möglich. „Erfreulicherweise wurde das aber sehr gut angenommen, zumal die Konsumenten die Vorteile des Systems erkannten und akzeptierten“, sagt Jana Heenen. Eine weitere Herausforderung war die Preiskalkulation, um die Erzeugnisse auch für alle erschwinglich zu machen. Dabei könne in Zukunft auch ein solidarisches System von sozialen Staffelpreisen hilfreich sein. „Durch die Transparenz bei einer Solawi ist zudem ersichtlich, wie sich die Produktionskosten zusammensetzen und was mit dem investierten Geld passiert“, so die Gärtnerin. Hinzu kommt die Logistik für die Verteilung der Gemüseboxen bei den Privatkunden, die sie auch in einem weiteren Umkreis organisieren muss.
Jana Heenen sieht neben den positiven ökologischen Aspekten dieser Art der Bewirtschaftung aber auch deren besondere Rolle bei der Grund- und Nahversorgung: „Wir benötigen mehr solcher Betriebe, um die regionale Produktion auszubauen und die Abhängigkeit von externen Märkten zu minimieren.“ Für sie sind sie ein wichtiger Schritt, um die Herkunft von Lebensmitteln transparenter zu machen und eine Antwort auf die Herausforderungen, vor denen die Landwirtschaft heute steht. Wichtig sei in diesem Zusammenhang zu verstehen, dass lokal und saisonal produzierte Lebensmittel die idealen Optionen sind. Durch eine Solawi können genau diese Aspekte vermittelt werden.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
SoLaWi Isartal
„Aus diesem Wunsch heraus ist die Solawi Isartal entstanden“, erklärt Eva Weigell, Ansprechpartnerin für Öffentlichkeitsarbeit in dem Unternehmen. Die Genossenschaft wurde im September 2021 gegründet und ist aus dem Verein Bürgerkraft Isartal e.V. sowie der Agenda Pullach 2023 hervorgegangen. „Das Ziel war es, ein zukunftsfähiges, genossenschaftliches Wirtschaften zu fördern“, so Weigell. Wie bei allen diesen Betrieben erfolgt die Finanzierung durch Mitgliederanteile. Zusätzlich kommen Spenden und Förderungen für ökologische Projekte zum Einsatz; zudem sei hoher ehrenamtlicher Einsatz notwendig, sei es beim Kistenpacken, Pflanzen oder Ernten.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
SoLaWi Isartal
Das strategische Ziel von 300 bis 400 Ernteteilern habe man bisher nicht erreichen können, beschreibt Eva Weigell die Situation. „Mit einer organisatorischen Änderung und einer starken Ausweitung der ehrenamtlichen Stellen für wichtige Funktionen steuerten wir 2024 dagegen." Für das Jahr 2025 liegen die Schwerpunkte bei neuen Ansätzen zur Mitgliedergewinnung und Kosteneffizienz. Unter anderem ist der Ausbau von Bildungsprojekten durch kooperierende Betriebe beabsichtigt. Langfristig sind 400 bis 500 Ernteteilende geplant, um stabil mit fairen Löhnen wirtschaften zu können. Zudem möchten wir das Gemüse an ausgewählte Vertriebspartner und Restaurants verkaufen und die Kooperation mit unserer Partner-Gärtnerei ausweiten, erläutert Weigell die weiteren Pläne für die Zukunft.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
SoLaWi Isartal