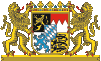Wasserrückhalt
Schwammregionen in Oberbayern
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
StMELF/Ländliche Verwaltung
(21.03.2025) Neuburg, Lkr. Neuburg-Schrobenhausen - Schwammregionen in Bayern gewinnen vielerorts stark an Bedeutung. Immer häufiger auftretende Überschwemmungen in Dörfern und den umliegenden Landschaften durch Extremwetterereignisse oder Dürreperioden fordern eine klimagerechte Anpassung. Als Gegensteuermaßnahme und um Dörfer und Flur bei der klimaresilienten Gestaltung zu unterstützen, wurde das Aktionsprogramm „Schwammregionen in Bayern“ ins Leben gerufen. Die ARGE Solidarischer Hochwasserschutz und die ILE Auerbergland e. V. sind Beispiele für erfolgreich umgesetzte Schwammregionen.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
ALE Oberbayern
(21.03.2025) Neuburg, Lkr. Neuburg-Schrobenhausen - Unter einer Schwammregion wird eine Region verstanden, die Regenwasser in Siedlungsbereichen und der umgebenden Landschaft speichert und auch wieder abgeben kann. Das Prinzip „Schwammregion“ bedeutet das Versickern von Wasser zu erleichtern. Dies kann zum Beispiel über begrünte Dächer, unversiegelte Bodenflächen und das intelligente Speichern von Niederschlagswasser erfolgen. In der Landschaft geht es um die Regulierung des Abflusses und des Rückhalts von Wasser. So ist es möglich auf zunehmende extreme Wetterereignisse zu reagieren und das gespeicherte Wasser im Sommer zur Kühlung oder Bewässerung zu verwenden.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
ALE Oberbayern
Das Aktionsprogramm „Schwammregionen in Bayern“ entstand als Gegensteuerungsmaßnahme der zunehmenden Extremwetterereignisse. Die Zielsetzung des Programmes ist es, Dörfer und Landschaften über kommunale Grenzen hinweg klimafest zu machen. Zudem gilt es die Gemeinden, die Land- und Forstwirtschaft und weitere Akteure im ländlichen Raum bei der Umsetzung und Entwicklung von eigenständigen und regional angepassten Lösungen zur klimaresilienten Entwicklung von Dorf und Flur zu unterstützen und zu fördern.
Im Rahmen des Aktionsprogramms wurde im Jahr 2024 ein bayernweiter Wettbewerb durchgeführt, bei dem sich vorhandene Gemeindeverbünde z.B. ILEs oder andere rechtsfähige Zusammenschlüsse von Gemeinden bewerben konnten. Voraussetzung für die Bewerbung waren Ideen für konkrete Maßnahmen einer klimaresilienten Entwicklung des regionalen Wasserhaushalts. 27 Gemeindeverbünde, Regionen oder Arbeitsgemeinschaften aus ganz Bayern hatten sich beworben. Von diesen wurden zehn Schwammregionen im November 2024 als Leuchtturmregionen und Pioniere von Staatsministerin Michaela Kaniber ernannt. Das jeweils zuständige Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) bezuschusst die Vorbereitung und Begleitung von Maßnahmen durch eine Umsetzungsbegleitung für drei Jahre. Im Folgenden werden die beiden oberbayerischen Schwammregionen vorgestellt.
Im Rahmen des Aktionsprogramms wurde im Jahr 2024 ein bayernweiter Wettbewerb durchgeführt, bei dem sich vorhandene Gemeindeverbünde z.B. ILEs oder andere rechtsfähige Zusammenschlüsse von Gemeinden bewerben konnten. Voraussetzung für die Bewerbung waren Ideen für konkrete Maßnahmen einer klimaresilienten Entwicklung des regionalen Wasserhaushalts. 27 Gemeindeverbünde, Regionen oder Arbeitsgemeinschaften aus ganz Bayern hatten sich beworben. Von diesen wurden zehn Schwammregionen im November 2024 als Leuchtturmregionen und Pioniere von Staatsministerin Michaela Kaniber ernannt. Das jeweils zuständige Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) bezuschusst die Vorbereitung und Begleitung von Maßnahmen durch eine Umsetzungsbegleitung für drei Jahre. Im Folgenden werden die beiden oberbayerischen Schwammregionen vorgestellt.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
ARGE „Solidarischer Hochwasserschutz“
Das Gebiet der „Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Solidarischer Hochwasserschutz“ umfasst neun Kommunen aus den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen an der Ilm. Die ARGE wurde in Folge des letzten Hochwassers an der Paar im Juni 2024 gegründet. Aktuell umfasst sie ein Gebiet von rund 324 km² mit rund 61.000 Einwohnern. Die Region ist durch intensive landwirtschaftliche Nutzung geprägt. So befindet sich in der Hallertau das weltweit größte Hopfenanbaugebiet, im Schrobenhausener Land dominieren Kartoffel und Spargelanbau. Prägendes Gewässer ist die Paar. Nördlich an das Gebiet grenzt das Donaumoos.
Probleme und Herausforderungen
Die letzten Hochwasserereignisse führten im Siedlungsbereich zu massiven finanziellen Schäden. Die Straßen und Böden weisen aktuell einen sehr hohen Versiegelungsgrad auf. Oberflächenwasser wird fast vollständig in die Kanalisation abgeleitet und dezentrale Versickerungsmöglichkeiten fehlen. Auch in der Flur fehlen natürliche Strukturen zur Wasserspeicherung. Gewässer sind stark begradigt, im letzten Jahrhundert wurden Senken zur besseren Bewirtschaftung aufgefüllt und hecken entfernt. Dies wirkt sich zunehmend negativ auf die Landwirtschaft aus. Abgeschwemmte Böden und Humusverlust bei Starkregen stehen deutlichen Ernteausfällen z.B. im Hopfenanbau wegen Trockenheit gegenüber. Trockenperioden werden aktuell durch künstliche Bewässerung ausgeglichen, was aufgrund sinkender Grundwasserspiegel zunehmend kritisch bewertet wird.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
ALE Oberbayern/Jojo Ensslin
Der Ansatz der ARGE besteht vor allem in der Umsetzung möglichst vieler keiner, dezentraler Maßnahmen, die in ihrer Gesamtheit eine große Wirkung entfalten sollen. So wurden bereits konkrete Flächen identifiziert, um erste Schritte zeitnah umzusetzen. Insgesamt wurden acht Projektansätze mit verschiedensten Maßnahmen definiert: Wasserrückhaltende und -abflussbremsende Maßnahmen sollen beispielsweise durch eine angepasste Bodennutzung und Landwirtschaft erreicht werden. Weiter sind konkrete Maßnahmen zur Flurgestaltung, z.B. in Form von natürlichen Überflutungsflächen (Auenbereiche), begrünten Abflussmulden, Rückhaltebecken oder der Schaffung von Feuchtflächen geplant. Im Fokus stehen hierbei kommunale und kreiseigene Flächen. Konkret soll der Kaltenthalgraben renaturiert werden. Mit Hilfe von Bauleitplanung und intensiver Informationsarbeit sollen auch die Siedlungsbereiche wassersensibel gestaltet werden, indem Versiegelung reduziert und wasserspeichernde Elemente wie Gründächer, Zisternen, Rigolen usw. einbaut werden.
Die Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) Auerbergland e.V. ist ein interkommunaler Zusammenschluss von 14 Gemeinden im Alpenvorland und erstreckt sich über eine Fläche von 341,14 Quadratkilometern über die drei Landkreise Weilheim-Schongau, Ostallgäu und Landsberg. In dem Gebiet leben ca. 26.340 Einwohner. Die Gemeinden im Auerbergland arbeiten seit den 1990er Jahren in verschiedenen Themen der Regionalentwicklung erfolgreich zusammen. Prägendes Merkmal und Namensgeber ist der Auerberg mit einer Höhe von 1.055 Metern. Die ILE Auerbergland weist eine ländliche Siedlungsstruktur auf, größere Verdichtungsräume fehlen. Mehr als 60 Prozent der Fläche wird landwirtschaftlich genutzt, wobei die Grünlandnutzung aufgrund der klimatischen Bedingungen überwiegt. Der Waldanteil liegt bei 25 Prozent. Das gesamte Gebiet ist stark durch Wasser geprägt. Zu nennen sind der Forggensee im Süden, der Lech mit seinen Auen und Zuflüssen, zahlreiche Moore (z.B. Premer Filz, Stöttener Moos) sowie eine Vielzahl an kleinen Gewässern, Seen und Bächen. Alles Wasser aus den Auerbergland-Gemeinden fließt über den Lech in die Donau. Wasserrückhaltende Strukturen haben deshalb auch positive Auswirkungen auf den Hochwasserschutz der flussabwärts liegenden Gemeinden an Lech und Wertach.
Die Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) Auerbergland e.V. ist ein interkommunaler Zusammenschluss von 14 Gemeinden im Alpenvorland und erstreckt sich über eine Fläche von 341,14 Quadratkilometern über die drei Landkreise Weilheim-Schongau, Ostallgäu und Landsberg. In dem Gebiet leben ca. 26.340 Einwohner. Die Gemeinden im Auerbergland arbeiten seit den 1990er Jahren in verschiedenen Themen der Regionalentwicklung erfolgreich zusammen. Prägendes Merkmal und Namensgeber ist der Auerberg mit einer Höhe von 1.055 Metern. Die ILE Auerbergland weist eine ländliche Siedlungsstruktur auf, größere Verdichtungsräume fehlen. Mehr als 60 Prozent der Fläche wird landwirtschaftlich genutzt, wobei die Grünlandnutzung aufgrund der klimatischen Bedingungen überwiegt. Der Waldanteil liegt bei 25 Prozent. Das gesamte Gebiet ist stark durch Wasser geprägt. Zu nennen sind der Forggensee im Süden, der Lech mit seinen Auen und Zuflüssen, zahlreiche Moore (z.B. Premer Filz, Stöttener Moos) sowie eine Vielzahl an kleinen Gewässern, Seen und Bächen. Alles Wasser aus den Auerbergland-Gemeinden fließt über den Lech in die Donau. Wasserrückhaltende Strukturen haben deshalb auch positive Auswirkungen auf den Hochwasserschutz der flussabwärts liegenden Gemeinden an Lech und Wertach.
Probleme und Herausforderungen
Zunehmende klein- und großräumige Starkregenereignisse mit Sturzflute und Hagel stellen die Region vor große Herausforderungen. In der Flur führen diese nicht nur zu Überschwemmungen und Hangrutschungen und damit verbundenen Ernteausfällen, sondern verursachen auch immer mehr Schäden an landwirtschaftlichen Wegen und landschaftsprägenden Elementen.
Trotz bestehender Hochwasserschutzmaßnahmen nehmen die Schäden im Siedlungsbereich deutlich zu. Die Intensität der Ereignisse führt zu Überlastung des Kanalsystems bzw. zu Vereisung der Sickerabflüsse durch Hagel. Die Speicherung von Brauchwasser in Privatgärten findet nur vereinzelt statt. Bäche innerhalb der Siedlungen sind i.d.R. verbaut oder kanalisiert. Dem Starkregen gegenüber stehen die Hitze- und Trockenperioden der letzten Jahre, die in einigen Gemeinden bereits zu signifikant sinkenden Grundwasserspielgel führten. Auch die Land- und Forstwirtschaft leidet zunehmend unter den Trockenperioden und damit verbundener Bodentrockenheit in Wald und Flur.
Trotz bestehender Hochwasserschutzmaßnahmen nehmen die Schäden im Siedlungsbereich deutlich zu. Die Intensität der Ereignisse führt zu Überlastung des Kanalsystems bzw. zu Vereisung der Sickerabflüsse durch Hagel. Die Speicherung von Brauchwasser in Privatgärten findet nur vereinzelt statt. Bäche innerhalb der Siedlungen sind i.d.R. verbaut oder kanalisiert. Dem Starkregen gegenüber stehen die Hitze- und Trockenperioden der letzten Jahre, die in einigen Gemeinden bereits zu signifikant sinkenden Grundwasserspielgel führten. Auch die Land- und Forstwirtschaft leidet zunehmend unter den Trockenperioden und damit verbundener Bodentrockenheit in Wald und Flur.
Lösungsansätze und Projektideen
Die ILE Auerbergland befasst sich bereits seit längerem mit der Thematik. Für elf Gemeinden liegt ein dezentrales, nichttechnisches Hochwasserschutzkonzept aus dem Jahre 2004 vor. In den letzten Jahren wurden mit den Projekten „Analyse und Bestandsaufnahme des landwirtschaftlichen Wegenetzes“ und „Klimafeste und wassersensible Landschaft Auerbergland“ zudem weitere wichtige fachliche Grundlagen erarbeitet.
In mehreren Workshops wurden hieraus eine Vielzahl an Projekten für das Auerbergland als Schwammregion entwickelt. In der Flur umfassen diese u.a. die Anlage von Versickerungsmulden, die Gestaltung landwirtschaftlicher Wege als wasserrückhaltende Elemente, die Förderung der Strukturvielfalt durch Einzelbäume, Hecken und Streuobstwiesen, eine angepasste Weidehaltung auf Moorböden, Moor- und Gewässerrenaturierungen sowie Erhalt wertvoller Auen. Im Siedlungsbereich sollen die „Eh-da Flächen“ der Gemeinden als wasserspeichernde, kühlende und biodiverse Grünelemente entwickelt werden. Zudem sollen die Grünstruktur (Einzelbäume, Dach- und Fassadenbegrünung) ausgebaut, Gewässer renaturiert und die Bevölkerung hinsichtlich wasserspeichernder Maßnahmen sensibilisiert werden.
In mehreren Workshops wurden hieraus eine Vielzahl an Projekten für das Auerbergland als Schwammregion entwickelt. In der Flur umfassen diese u.a. die Anlage von Versickerungsmulden, die Gestaltung landwirtschaftlicher Wege als wasserrückhaltende Elemente, die Förderung der Strukturvielfalt durch Einzelbäume, Hecken und Streuobstwiesen, eine angepasste Weidehaltung auf Moorböden, Moor- und Gewässerrenaturierungen sowie Erhalt wertvoller Auen. Im Siedlungsbereich sollen die „Eh-da Flächen“ der Gemeinden als wasserspeichernde, kühlende und biodiverse Grünelemente entwickelt werden. Zudem sollen die Grünstruktur (Einzelbäume, Dach- und Fassadenbegrünung) ausgebaut, Gewässer renaturiert und die Bevölkerung hinsichtlich wasserspeichernder Maßnahmen sensibilisiert werden.